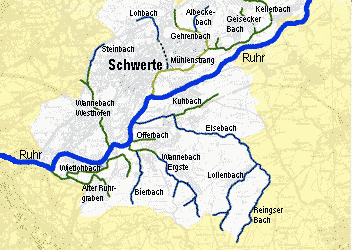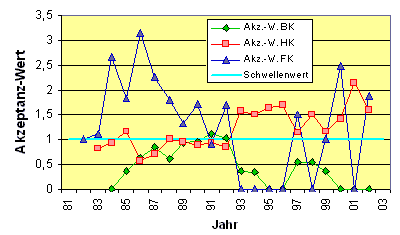| Wasseramsel |  |
Die Wasseramsel in Schwerte
Dieser Aufsatz erschien in der Zeitschrift Charadrius 39, Heft 1-2 2003: 95-98 unter dem etwas unhandlichen Titel:
Bestandsentwicklung der Wasseramsel (Cinclus cinclus)
im Raum Schwerte zwischen
1981 und 2002 im Raum Schwerte in Abhängigkeit vom Angebot unterschiedlicher
Nisthilfen
Von KURT STAEDTLER, KLAUS BREMSHEY & IRIS HEYNEN
 |
| Wasseramsel am Refflingser Bach. |
Zusammenfassung
Zwischen 1981 und 2002 ist für die Wasseramsel in einem Bachsystem der Ruhr bei Schwerte (NRW) aktive Nisthilfe betrieben worden. Akzeptanz und Effizienz in Bezug auf Brutplatzwahl und Populationsentwicklung wurden für Nistkästen unterschiedlicher Bauweise dokumentiert und ausgewertet. Der Versuch, mit getarnten Baumkästen Brutpaare anzusprechen, scheint als eigenständige Artenschutzmaßnahme fehlgeschlagen zu sein. Eine temporäre Zuwanderung von Wasseramseln in das Untersuchungsgebiet steht möglicherweise im Zusammenhang mit einem Totalverlust an Lebensraum durch den Aufstau der nahe gelegenen Wupper-Talsperre.
Summary
 |
| Lebensraum der Wasseramsel - hier der Wannebach bei Tiefendorf - mit getarntem Baumkasten (Pfeil). |
Population development of White-throated Dipper (Cinclus cinclus) in the Schwerte region of the German federal state of North Rhine-Westphalia between 1981 and 2002 and its dependence on the availability of artificial nest constructions. In a stream systern near Schwerte artificial nesting constructions have been provided for White-throated Dipper between 1981 and 2002. Acceptance and efficiency in relation to breeding site choice and population development were documented and evaluated for different types of nest box. The attempt to appeal to prospecting breeding pairs by offering camouflaged nest boxes was an apparent failure. A temporary immigration of White-throated Dippers into the survey area is possibly connected with the total loss of habitat arising from the damming of the nearby Wupper river valley.
Einleitung
| Die Wasseramsel ist eine eng an ihren Lebensraum angepasste Vogelart. Da sie ihre Nahrung ausschließlich in Fließgewässern findet, reagiert sie empfindlich auf Veränderungen der Wasserqualität und ist somit eine geeignete Indikatorart für Gewässerbelastung. Auch das Nest wird stets in unmittelbarer Nähe des Wassers gebaut. Die Neststandorte sind dabei vielfältig - oft nutzt die Wasseramsel vom Menschen geschaffene Strukturen |
wie Brücken oder Mauern in Bach- oder Flussnähe, um in einer geeigneten Nische zu brüten. Wo solche Nistgelegenheiten fehlen, nimmt die Wasseramsel auch künstliche Nisthilfen an. In der Roten Liste für Nordrhein-Westfalen (GRO & WOG 1997) wird die Wasseramsel als "derzeit nicht bedroht, aber von Naturschutz-Maßnahmen abhängig" eingestuft (Zusatzkategorie N); ihr Bestand wird in NRW auf 1.500-2.500 Brutpaare geschätzt. |
Material und Methoden
|
Das Untersuchungsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Ornithologie und Naturschutz - AGON Schwerte - liegt am östlichen Rand des Ruhrgebiets im Übergangsbereich des Süderberglands und der Ausläufer des Ardeygebirges, welches die südliche Grenze der Westfälischen Bucht bildet. In dieser Studie wurden die Fließgewässer im Einzugsbereich der Ruhr auf der Basis des MTB 4511 Schwerte bearbeitet (Abb. 1). Diese liegen zwischen 100 und 250 m ü. NN und sind nach der Gewässerkarte von 2000 des Kreises Unna zumeist gering (I-II) oder mäßig (II) belastet. Nur Gehrenbach und Mühlenstrang sind kritisch belastet (II-III). Die Wasseramsel hat hier ihre nordwestliche Verbreitungsgrenze, wobei aus den 1970er Jahren nur einzelne Wasseramselbeobachtungen vorliegen und Bruten nicht bekannt wurden. 1981 wurde erstmals ein Wasseramselnest in einem unter einer Brücke angeschwemmten Plastikeimer gefunden; die ca. acht Tage alten Jungen waren tot. Dieser Brutnachweis gab den Anstoß zu dem Versuch, im Rahmen einer Langzeituntersuchung den Bestand der Wasseramsel durch das gezielte Anbieten künstlicher Nistgelegenheiten zu stabilisieren (STAEDTLER & BREMSHEY 1988). Dabei kamen drei Typen von Nistkästen zum Einsatz: Eternit- bzw. Faserbetonkästen (FK), Holzkästen (HK) und Baumkästen (BK). Mit Unterstützung des Umweltamts Unna wurden erstmals 1982 zehn Faserbetonkästen (Fa. Schwegler) beschafft und an geeigneten Stellen, vorwiegend unter Brücken, angebracht. Seit 1983 ist die Zahl der Nisthilfen nach und nach durch selbstgebaute Holzkästen erweitert worden (BWW 1990, JOST 1970). Ab 1984 wurden in Bachabschnitten, die keine oder zu niedrige Brücken aufwiesen, |
weitere Holzkästen an Bäumen, Baumstümpfen und unter Wurzelballen angebracht.Diese "Baumkästen" waren mit Erde, Baumrinde und Moos so verkleidet, dass sie im Gelände kaum auffielen. Ausgehend von zehn Kästen im Jahr 1982 wurde die Anzahl der Nisthilfen rasch ausgebaut und bewegte sich über 19 Jahre hinweg (1984-2002) stets zwischen 28 und 46 Kästen (Abb. 2). Der Anteil der drei Kastentypen am Gesamtangebot verschob sich während dieses Zeitraums. Da nach 1982 keine Faserbetonkästen mehr angeschafft wurden, nahm deren Anzahl durch Ausfälle stetig ab. Die Zahl der Holzkästen wuchs zunächst bis 1985 auf 27 an, um dann gegen Ende des Beobachtungszeitraums wieder abzunehmen. Die Anzahl der Baumkästen blieb dagegen relativ konstant (Abb. 2).
|
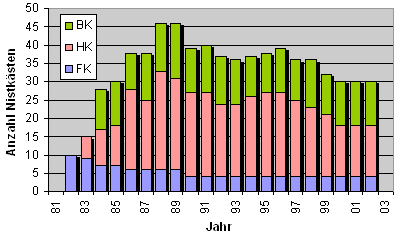 |
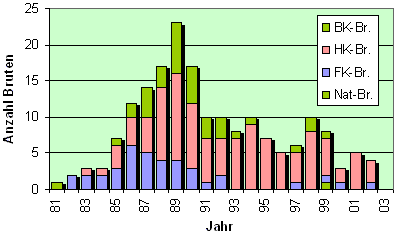 |
| Abb. 2: Anzahl angebotener Nistkästen von 1981-2002 (BK=Baumkasten, HK=Holzkasten, FK=Faserbetonkasten). | Abb. 3: Anzahl der registrierten Wasseramselbruten und Grad der Nistkastenbelegung. |
Ergebnisse
|
Beginnend mit der 1981 beobachteten ersten Brut stieg die Anzahl der registrierten Erst- und Zweitbruten bis 1989 parallel zum wachsenden Kastenangebot an, ging dann aber wieder zurück, obwohl nach wie vor viele Kästen zur Verfügung standen (Abb. 3). Dabei betrug die Anzahl der Zweitbruten max. 5 von 23 im Jahr 1989 und ging danach ab Mitte der 1990er Jahre auf Null zurück. Parallel zur Anzahl der jährlichen Bruten verlief auch der Auslastungsgrad der Nistkästen. Um eine Bevorzugung eines Kastentyps zu erkennen, wurde wegen deren unterschiedlicher Verfügbarkeit eine Standardisierung vorgenommen. Dazu wurde der Quotient aus dem prozentualen Anteil der Bruten in dem betreffenden Nisthilfentyp und dem prozentualen Anteil dieses Typs am Gesamtangebot gebildet. Dadurch erhält man einen "Akzeptanzwert", der eine über- (Werte >1) oder unterdurchschnittliche (Werte <1) Nutzung eines Kastentyps anzeigt. Die Akzeptanzwerte weisen starke Schwankungen auf, die zumindest bei den Faserbetonkästen zum Teil wahrscheinlich auch auf den geringen Stichprobenumfang zurückzuführen sind (Abb. 4). In den ersten Jahren wurden die Faserbetonkästen bevorzugt, in der zweiten Hälfte des |
|
Diskussion
|
Mit wachsendem Nistkastenangebot stieg zunächst auch die Anzahl der Wasseramselbruten pro Jahr sowie die Auslastung der Brutkästen an. Ab ca. 1991 ist trotz bleibender Verfügbarkeit einer großen Anzahl von Nisthilfen ein langsamer Rückgang der Wasseramselbruten und damit der Auslastung festzustellen. Die Ursache dafür ist unklar, da nach der Gewässergütekarte des Kreises Unna und auch nach eigenen Beobachtungen fast alle Bäche im Untersuchungsgebiet eine reichhaltige Tierwelt - vor allem Köcherfliegenlarven - besitzen. Nahrung sollte also genügend vorhanden sein. Für eine Gewässerversauerung (Vgl. ZANG 2003) liegen bislang keine Anhaltspunkte vor. Beim Vergleich der drei Kastenmodelle ist festzustellen, dass Faserbetonkästen und Holzkästen gegenüber den Baumkästen bevorzugt werden. Dies ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf den vergleichsweise suboptimalen Standort der Baumkästen zurück zu führen (frei statt unter einer Brücke) und könnte mit dem geringeren Feuchtegrad und dem damit verbundenen größeren Risiko für einen Befall mit Ektoparasiten zusammenhängen (vgl. HEGELBACH & STUCKi 2003). Wie zu erwarten, werden für Prädatoren schwer zugängliche Stellen für den Nestbau bevorzugt (CREUTZ 1986). Faserbetonkästen wurden vor allem in der ersten Hälfte des Untersuchungszeitraums bevorzugt, später dann die Holzkästen. Möglicherweise spiegelt dies Alterungserscheinungen bei den nie erneuerten |
Faserbetonkästen wider. Die Baumkästen wurden dagegen nur zu Zeiten mit Brutbestandsmaxima genutzt, weisen also eher auf pessimale Brutorte hin. Insgesamt scheint es jedoch nicht gelungen zu sein, mit Hilfe von Nistkästen eine stabile Population aufzubauen und zu stabilisieren. Da keine Daten zum Reproduktionserfolg vorliegen, kann dieser nicht in die Betrachtung einbezogen werden. Der Populationsverlauf lässt jedoch auf eine
Abhängigkeit von den Kernsiedlungsbereichen schließen. Von
hier aus wird offenbar das am Rande des Verbreitungsgebiets liegende Bachsystem
der Ruhr kolonisiert - aber auch wieder verlassen. In diesem Zusammenhang
gewinnen Beobachtungen von farbig markierten Wasseramseln aus dem Siedlungsgebiet
der Wupper zwischen Hückeswagen und Krebsöge, der jetzigen Wupper-Talsperre,
eine aufschlussreiche Bedeutung (MÖNIG 1993). So wurden zwischen
1988 und 1991 wiederholt farbig markierte Individuen der ehemaligen Population
dieses Wupperabschnittes oberhalb wie unterhalb der Talsperre gesichtet,
u.a. auch am Enderbach bei Wetter (FELLENBERG 1991). Die Ergebnisse des
vorliegenden Beitrags zeigen jedoch, dass die erzwungene Dismigration
aus einem aufgestauten Flussabschnitt mit immerhin 14 Brutrevieren andernorts
zu keiner nachhaltigen Neuansiedlung führte. |
 |
 |
 |
 |
| Wasseramsel bei der Nahrungssuche im Reingser Bach. Sie sucht unter Steinen... | ... nach Köcherfliegenlarven - hier in einer Petrischale. Gefangene Larven... | ...werden auf den Stein geschlagen und so vom Köcher befreit. Die erbeuteten... | ...Larven werden wie mit einer Grillzange im Schnabel zum Nest gebracht. |
Literatur
BUNDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT BWW (1990): Hinweise zum Bau von Brutnischen für Wasseramsel und Bergstelze. Bern.
CREUTZ, G. (1986): Die Wasseramsel Cinclus cinclus. A. Ziernsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.
FELLENBERG; W. (1991): 23. Ornithologischer Sammelbericht für Westfalen. Charadrius 27: 88-96.
GRO & WOG (1997): Rote Liste der gefährdeten Vogelarten NordrheinWestfalens. Charadrius 33: 69-116.
HEGELBACH, J. & S. STUCKI (2003): Neststandort und Bruterfolg der Wasseramsel (Cinclus cinclus) und der Befall mit Milben (Acari), insbesondere der Nördlichen Vogelmilbe (Ornithonyssus sylviarum). Charadrius 39: 89-94.
JOST, 0. (1970): Erfolgreiche Schutzmaßnahmen in den Brutrevieren der Wasseramsel (Cinclus cinclus). Angew. Omithol. 3: 101-108.
MÖNIG, R. (1993): Veränderungen der Avifauna eines Flußabschnittes durch Errichten einer Talsperre. Artenschutzreport 3: 31-36.
STAEDTLER, K. & K. BREMSHEY (1988): Bestandsentwicklung der Wasseramsel (Cinclus cinclus) durch Nisthilfen im Raum Schwerte/Ruhr. Egretta 31: 38-41.
ZANG, H. (2003). Zur Entwicklung der Wasseramsel-Population (Cinclus cinclus) in Niedersachsen. Charadrius 39:79-88.
Eingereicht (an Charadrius): 20.03.2003
Zusätzliche Fotos: AGON/Ackermann